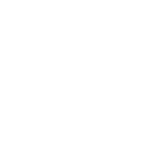Baronin Léonie de Waha
Als Tochter aus zwei großen liberalen Adelsfamilien wurde Léonie Marie Laurence de Chestret de
Haneffe am 03. März 1836 in Tilff in der Provinz Lüttich geboren. Ihr Vater war der Baron und
spätere Senator Hyacinthe de Chestret de Haneffe und ihre Mutter die adlige Amanda Laurence
de Sélys Longchamps.
Im Alter von zwei Jahren verstarb bereits ihre Mutter, weshalb Léonie im Schloss Colonster aufwuchs und durch ihren Vater und private Tutoren erzogen wurde. Sie entwickelte sich zu einer liberalen, demokratischen, toleranten und gläubigen Frau, die ein großes Interesse an Geschichte innehielt und lernte mehrere Sprachen zu sprechen.
Mit 27 Jahren heiratete sie 1863 den Baron und Rechtswissenschaftler Louis Auguste de Waha- Baillonville, mit dem sie nach drei Jahren Ehe eine Tochter bekam. Diese verstarb jedoch noch im Säuglingsalter und kurz darauf erlitt Léonie de Waha einen weiteren Schicksalsschlag, als ein Jahr später auch ihr Ehemann starb.
Nach dem Tod ihres Mannes entschloss sie sich vermehrt für ihre Mitmenschen einzusetzen, sich der Emanzipation zu widmen und darüber hinaus die gemeinnützige Arbeit ihres Mannes fortzusetzen. Am 8. Juli 1926 verstarb sie im hohen Alter von 90 Jahren in ihrem Zuhause in Tilff und wurde 2012 posthum zum „officier du Mérite wallon“ (dt. Wallonischer Verdienstoffizier) ernannt.
Im Alter von zwei Jahren verstarb bereits ihre Mutter, weshalb Léonie im Schloss Colonster aufwuchs und durch ihren Vater und private Tutoren erzogen wurde. Sie entwickelte sich zu einer liberalen, demokratischen, toleranten und gläubigen Frau, die ein großes Interesse an Geschichte innehielt und lernte mehrere Sprachen zu sprechen.
Mit 27 Jahren heiratete sie 1863 den Baron und Rechtswissenschaftler Louis Auguste de Waha- Baillonville, mit dem sie nach drei Jahren Ehe eine Tochter bekam. Diese verstarb jedoch noch im Säuglingsalter und kurz darauf erlitt Léonie de Waha einen weiteren Schicksalsschlag, als ein Jahr später auch ihr Ehemann starb.
Nach dem Tod ihres Mannes entschloss sie sich vermehrt für ihre Mitmenschen einzusetzen, sich der Emanzipation zu widmen und darüber hinaus die gemeinnützige Arbeit ihres Mannes fortzusetzen. Am 8. Juli 1926 verstarb sie im hohen Alter von 90 Jahren in ihrem Zuhause in Tilff und wurde 2012 posthum zum „officier du Mérite wallon“ (dt. Wallonischer Verdienstoffizier) ernannt.
Gemeinnützige Arbeit
Nachdem sie in jungen Jahren ihren Mann verlor, beschloss sie mehr in die Ausbildung von
Mädchen und Frauen zu investieren, die meist bloß von katholischen Institutionen unterstützt
wurden. Doch sie wollte auch außerhalb dessen Anlaufstellen anbieten, um einer breiteren
Bevölkerung Zugang zu erlauben.
Die Arbeit ihres Mannes führte sie weiter, indem sie Bibliotheken in Chênée und Esneux erbauen ließ und zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen unterstützte.
Um die soziale Lage in der Region weiter zu fördern, gründete de Waha eine Schneiderschule in Tilff und trug zur Entwicklung von Kindergärten und Schulen im Bezirk Saint-Gilles bei. Gemeinsam mit dem liberalen Parlamentarier, Julien d'Andrimont, unterstützte sie die Gründung von Arbeiterhäusern, die nach dem Mulhouse-System funktionierten. Dies eröffnete den Mietern nach sechzehn Jahren Eigentümer der Wohnung zu werden, was zu einer Verbesserung der Lebenslage führte.
Die Arbeit ihres Mannes führte sie weiter, indem sie Bibliotheken in Chênée und Esneux erbauen ließ und zahlreiche Wohltätigkeitsorganisationen unterstützte.
Um die soziale Lage in der Region weiter zu fördern, gründete de Waha eine Schneiderschule in Tilff und trug zur Entwicklung von Kindergärten und Schulen im Bezirk Saint-Gilles bei. Gemeinsam mit dem liberalen Parlamentarier, Julien d'Andrimont, unterstützte sie die Gründung von Arbeiterhäusern, die nach dem Mulhouse-System funktionierten. Dies eröffnete den Mietern nach sechzehn Jahren Eigentümer der Wohnung zu werden, was zu einer Verbesserung der Lebenslage führte.
„Lycée de Waha“
Da es bis zum Ende des 19. Jahrhunderts für Mädchen keine Möglichkeit gab, außerhalb von
Klöstern und katholischen Schulen, einen Bildungsabschluss zu erreichen, der ihnen den Zugang
zur Universität ermöglicht, wandte sich der damalige Bürgermeister von Lüttich an Léonie de
Waha. Sie unterstützte seine Idee ein Lyzeums zu errichten und kaufte somit ein Gebäude in der
Rue Hazinelle, um dort 1868 das „Institut supérieur de demoiselles“ (dt. Höheres Institut für junge
Damen) zu gründen. Die Schule sollte jungen Frauen nach langer Zeit den Zugang zu einer
Hochschulbildung ermöglichen.
Besonders der optionale Religionsunterricht wurde pluralistisch gestaltet, indem dieser bei katholischen, protestantischen oder jüdischen Geistlichen genommen werden konnte. Gerade dies stieß bei dem Bischof von Lüttich auf Kritik und er drohte mit der Exkommunikation aller, die die Schule besuchten. Erst der nachfolgende Bischof widerruf dieses Urteil.
Später wurde die Schule von der Provinz subventioniert, wodurch die Registrierung an dieser Schule kostenfrei wurde, was ebenfalls zur Verbesserung des lokalen Bildungssystems beitrug. Daraufhin erhielt die Schule den Namen Lycée de Waha.
Besonders der optionale Religionsunterricht wurde pluralistisch gestaltet, indem dieser bei katholischen, protestantischen oder jüdischen Geistlichen genommen werden konnte. Gerade dies stieß bei dem Bischof von Lüttich auf Kritik und er drohte mit der Exkommunikation aller, die die Schule besuchten. Erst der nachfolgende Bischof widerruf dieses Urteil.
Später wurde die Schule von der Provinz subventioniert, wodurch die Registrierung an dieser Schule kostenfrei wurde, was ebenfalls zur Verbesserung des lokalen Bildungssystems beitrug. Daraufhin erhielt die Schule den Namen Lycée de Waha.
zum Schließen herumklicken
„Union des femmes de Wallonie“
Neben ihrem Engagement für bessere Bildungschancen setzte sich Léonie de Waha bereits Ende
des 19. Jahrhunderts für die Verbesserung der Frauenrechte ein, die das Frauenwahlrecht und ein
besseres Arbeitsumfeld umfassten.
Dadurch war es unter anderem ihr Ziel, das Selbstvertrauen der Frauen zu verbessern, das Bewusstsein für gleiche Rechte zu stärken sowie die finanzielle Unabhängigkeit zu unterstützen. Um das wallonische politische Bewusstsein der Frauen zu fördern, gründete Léonie de Waha die „Union des femmes de Wallonie“ (dt. „Union der Wallonischen Frauen“), die sich mit der Autonomie Walloniens und der Emanzipation befasste.
Alle Frauen waren dazu eingeladen, der Union beizutreten, die sich um Gerechtigkeit, Solidarität und die Heimatliebe kümmerten. Um dies auszudrücken und das politische Bewusstsein zu stärken, unternahmen sie verschiedene Aktivitäten und veröffentlichten ein passendes Bulletin.
Auch verfasste Léonie de Waha selbst Artikel für unterschiedliche wallonische Zeitschriften wie „La Barricade“ und „La Femme wallonne“ und leitete die Union noch mit 90 Jahren, bis sie 1926 verstarb.
Dadurch war es unter anderem ihr Ziel, das Selbstvertrauen der Frauen zu verbessern, das Bewusstsein für gleiche Rechte zu stärken sowie die finanzielle Unabhängigkeit zu unterstützen. Um das wallonische politische Bewusstsein der Frauen zu fördern, gründete Léonie de Waha die „Union des femmes de Wallonie“ (dt. „Union der Wallonischen Frauen“), die sich mit der Autonomie Walloniens und der Emanzipation befasste.
Alle Frauen waren dazu eingeladen, der Union beizutreten, die sich um Gerechtigkeit, Solidarität und die Heimatliebe kümmerten. Um dies auszudrücken und das politische Bewusstsein zu stärken, unternahmen sie verschiedene Aktivitäten und veröffentlichten ein passendes Bulletin.
Auch verfasste Léonie de Waha selbst Artikel für unterschiedliche wallonische Zeitschriften wie „La Barricade“ und „La Femme wallonne“ und leitete die Union noch mit 90 Jahren, bis sie 1926 verstarb.
Die Autonomie der Wallonie
Die Autonomie Walloniens war ein langes und wichtiges Anliegen Léonie de Wahas. Besonders
als die Bewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts wuchs, korrespondierte sie mit den leitenden
Personen Julien Delaite und Jules Destrée.
Auch an ihrer weiterführenden Schule legte sie einen großen Wert auf die lokale Geschichte und vermittelte den Schülerinnen, sich mit ihrer Region verbunden zu fühlen.
Es war ihr Vorschlag, die Farben von Lüttich als Wahrzeichen der Wallonie zu verwenden. Auch die Gaillarde, eine rot-gelbe Kokardenblume als Emblem zu nutzen, war ihr Vorschlag. Bis heute sind die Farben und die Blume Zeichen der Wallonie. Eine der höchsten Auszeichnungen der Region stellt ebenfalls eine silberne Gaillarde dar.
Auch an ihrer weiterführenden Schule legte sie einen großen Wert auf die lokale Geschichte und vermittelte den Schülerinnen, sich mit ihrer Region verbunden zu fühlen.
Es war ihr Vorschlag, die Farben von Lüttich als Wahrzeichen der Wallonie zu verwenden. Auch die Gaillarde, eine rot-gelbe Kokardenblume als Emblem zu nutzen, war ihr Vorschlag. Bis heute sind die Farben und die Blume Zeichen der Wallonie. Eine der höchsten Auszeichnungen der Region stellt ebenfalls eine silberne Gaillarde dar.